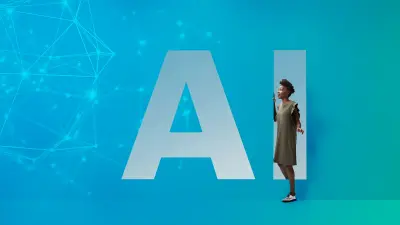KI, die bewegt
Bosch erleichtert mit Algorithmen den Alltag
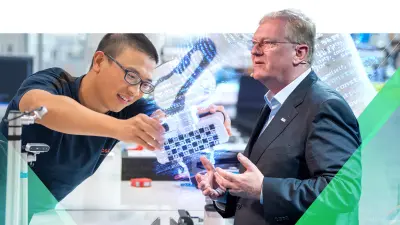
24.06.2025
Mit großen Begriffen sollte man sparsam umgehen. Nicht jeder Fortschritt bringt eine Zäsur, nicht jede Erfindung ist epochal. Was wir derzeit jedoch bei der Künstlichen Intelligenz beobachten können, rechtfertigt nahezu jede sprachliche Zuspitzung. Autos, Flugzeuge, Computer und Internet haben die Welt zwar spürbar verändert – den Blick des Menschen auf sich selbst aber nur wenig beeinflusst. Die KI wird hier viel weitreichendere Wirkung haben, in der Menschheitsgeschichte wohl am ehesten mit der Erfindung des Buchdrucks vergleichbar. Sie ist viel mehr als nur eine neue Technologie. Sie kann in den kommenden Jahrzehnten unseren Alltag und auch die Art, wie wir als Menschen über uns selbst denken, wesentlich verändern.
von Stefan Hartung
Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH
Die Anwendung von KI, das wissen wir alle, ist nicht frei von Risiken – das ist wie bei anderen Technologien auch. Ich bin aber überzeugt, dass die Chancen deutlich überwiegen – zumindest dann, wenn wir im Umgang mit KI auch zukünftig unseren eigenen Verstand und unsere eigene Vernunft nicht hinter uns lassen. Bei Bosch sind wir jedenfalls fest entschlossen, sowohl künstliche wie auch menschliche Intelligenz weiter konsequent zu nutzen, um unser großes Thema voranzutreiben – die „Technik fürs Leben“.
Die Künstliche Intelligenz ist bei Bosch längst raus aus den Testlaboren. Sie ist Alltag: in unserer Strategie, in der Entwicklung, in unseren Prozessen. Und in unseren Produkten und Lösungen sowieso. Schon seit zwei Jahren ist alles, was wir anbieten, entweder selbst mit KI ausgestattet oder mit ihrer Hilfe entwickelt beziehungsweise hergestellt worden.
Für die meisten Menschen bedeutet künstliche Intelligenz bislang nicht viel mehr als eine willkommene und faszinierende Unterstützung bei der Erstellung von Texten oder Bildern. Ihr wahres Potenzial zeigt die KI aber weniger an den Bildschirmen und im rein Virtuellen, sondern dort, wo sie auf die physische Welt trifft, also überall da, wo sich Dinge bewegen, wo Technik dem Menschen das Leben einfacher macht. Oder anders gesagt: Da, wo man auch uns findet. Denn Bosch ist bei dieser Entwicklung ganz vorne mit dabei. Unsere Stärke liegt schließlich genau in dieser Verbindung: Wir bringen KI und tiefes industrielles Wissen zusammen.

Bis Ende 2027 wollen wir deshalb mehr als 2,5 Milliarden Euro in die Künstliche Intelligenz investieren. Ziel ist es, unsere Prozesse mit KI noch schneller und unsere Produkte noch innovativer zu machen. Und schon jetzt sorgt KI von Bosch für mehr Sicherheit und Komfort im Alltag. Ich kann hier nur ein paar Beispiele von vielen nennen: Auf dem eBike ist die Sorge um die Reichweite dank der KI-basierten „Range Control“ kein Thema mehr. Auf der Baustelle entdeckt unser Wandscanner Metall oder elektrische Leitungen im Mauerwerk durch bloßes „Wandauflegen“ – ebenfalls mit KI. Und in der Küche steuert der Backofen der Serie 8 die richtige Garmethode und Temperatur für mehr als 80 automatisch erkannte Gerichte.
KI-basierten Lösungen entwickeln sich zunehmend zum Standard in der Automobilindustrie
Künstliche Intelligenz wird aber nicht nur ein starker Innovationsbooster in all unseren Bereichen sein. Sie wird auch unser Wachstum spürbar antreiben. Zum Beispiel in der Mobilität. Bosch hat mit der ADAS-Produktfamilie automatisierte Fahrsysteme für verschiedene Fahrzeugklassen entwickelt. Dabei analysieren lernfähige Algorithmen die von unseren KI-optimierten Sensoren eingehenden Daten und werten sie aus. Das Fahrzeug kann dadurch zwischen Fußgängern, Autos oder Hindernissen unterscheiden und auch das wahrscheinliche Verhalten der dynamischen Objekte einschätzen – fast wie ein Mensch. Mit dem Unterschied, dass die Technik niemals müde wird.

Solche KI-basierten Lösungen entwickeln sich zunehmend zum Standard in der Automobilindustrie – und werden das assistierte und automatisierte Fahren in Zukunft sicher und zuverlässig ermöglichen. Noch hat sich diese Dynamik nicht vollends entfalten können, weder im Markt, und daher auch nicht bei Bosch. Dennoch steht für uns außer Frage, dass sich das automatisierte Fahren durchsetzen wird. Wir bieten dafür die passenden Lösungen, und sind deshalb langfristig unverändert zuversichtlich: Unser Umsatz mit Software, Sensorik, Hochleistungscomputern und Netzwerkkomponenten wird sich bis Mitte der 2030er Jahre voraussichtlich verdoppeln – auf dann deutlich mehr als zehn Milliarden Euro.
Unsere besondere Stärke in diesem Bereich ist die Verbindung unserer weltweit gesammelten und gelagerten Daten mit sogenannten kollaborativen KI-Trainingstechniken. In den vergangenen Jahren haben wir überall auf der Welt mit unserer Sensorik eine riesige Menge an Verkehrssituationen zusammengetragen, mit denen wir nun unsere KI-Modelle trainieren können. Insgesamt umfassen die Daten deutlich mehr als 200 Petabyte beziehungsweise 200 Millionen Gigabyte. Für das Training nutzen wir das sogenannte föderierte Lernen. Das ist ein maschinelles Lernverfahren, bei dem eine gemeinsame KI-Anwendung über mehrere, weltweit verteilte Server hinweg trainiert wird. Dabei werden zwar verschiedene Parameter miteinander ausgetauscht, nicht aber die Daten selbst. Und weil manche Länder den Export von Daten erschweren oder ganz verbieten, ist dieses Verfahren ein entscheidender Vorteil, der unsere Entwicklungszeit erheblich verkürzt.
KI gehört also längst zum Kerngeschäft bei Bosch. Rund 5 000 Experten arbeiten in verschiedensten Bereichen an der Entwicklung und am Einsatz von KI. Kein anderes Unternehmen hat beim Europäischen Patentamt in der Zeit seit 2013 mehr KI-Patente angemeldet als Bosch. Das liegt auch daran, dass nur wenige andere Technologieunternehmen hier so früh eingestiegen sind wie wir. Schon 2017 haben wir das Bosch Center for Artificial Intelligence gegründet. Mittlerweile hat es vier Standorte: Renningen, Pittsburgh, Bangalore und Haifa. Damit sind wir immer bestens über alles informiert, was in der KI-Welt diskutiert, vorgedacht und realisiert wird.
Dazu zählen natürlich nicht nur technologische Trends, sondern auch gesellschaftliche und politische Dimensionen der KI. Der Wettbewerb der großen Weltregionen wird schließlich nicht allein in den Entwicklungszentren entschieden. Und momentan sieht es im globalen Vergleich leider so aus, als ob Europa seine KI-Zukunft mit überzogener Regulierung unnötig verzögern würde. Die EU will bekanntlich europaweit einheitliche Regeln für eine vertrauenswürdige KI einführen. Das ist grundsätzlich richtig, denn erstens ist KI kein Selbstzweck, sondern soll dem Menschen dienen, und zweitens wird sie sich kommerziell nur durchsetzen, wenn die Kunden der jeweiligen Lösung auch wirklich vertrauen.
Aber: Für die Umsetzung der EU-Verordnung brauchen Entwickler und Unternehmen klare Vorgaben und definierte Standards. Deren Einführung jedoch kommt nun deutlich später, und das sorgt gerade bei den sogenannten Hochrisiko-Systemen, wozu unter anderem auch das automatisierte Fahren zählt, für Unklarheiten. Zusätzlich müssen KI-Systeme kontinuierlich geprüft, überwacht und dokumentiert werden. Diese Mischung aus Bürokratie und strengen, aber unklaren Vorgaben macht den Standort Europa für KI-Unternehmen deutlich weniger attraktiv als andere Weltgegenden.
Europa muss industrielle Erfahrung als Wettbewerbsvorteil nutzen
Wir müssen hier gegensteuern. Denn der Umgang mit KI ist nicht nur eine Frage der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch der politischen Freiheit: In Zukunft wird eine Gesellschaft ohne herausragende KI-Fähigkeiten zunehmend in Abhängigkeit von anderen geraten. Was uns heute an Mut fehlt, fehlt uns morgen an Sicherheit und Souveränität. Dabei ist eines klar: diese Herausforderungen werden wir nicht meistern, indem wir den technologischen Fortschritt bremsen. Sondern indem wir ihn lenken. Sonst verlieren wir den Anschluss: Die Universität Stanford gibt einmal im Jahr ihren AI-Index zum aktuellen Stand der Technik heraus. Demnach wurden im vergangenen Jahr in den USA 40 nennenswerte KI-Modelle entwickelt, in China 15, und in Europa drei.
Dabei verfügt doch gerade Europa über einen enormen Wettbewerbsvorteil – nämlich über einen einzigartigen Schatz an industrieller Erfahrung mitsamt den entsprechenden Daten. Wenn es uns gelingt, dieses Wissen mit zukunftsweisenden KI-Anwendungen zu verbinden, dann können wir mit unserer Industrie auch im 21. Jahrhundert an der Weltspitze mitspielen.
Dafür brauchen wir allerdings mehr als nur eine politische Regulierung mit Augenmaß. Wir brauchen auch eine Gesellschaft, die der KI möglichst gut informiert und ausgebildet entgegensieht. Die Ergebnisse unseres diesjährigen Bosch Tech Compass sind in dieser Hinsicht leider eher ernüchternd. Dabei handelt es sich um eine Umfrage, mit der wir einmal im Jahr untersuchen, was die Menschen in führenden Industrieländern von modernen Technologien halten. So fühlen sich in Indien und China jeweils rund drei Viertel der Befragten gut auf das kommende KI-Zeitalter vorbereitet. In Deutschland sind es gerade einmal 35 Prozent. Zugleich aber halten 72 Prozent der Deutschen KI für die einflussreichste Technologie der kommenden zehn Jahre. Das ist ein Missverhältnis, das wir geraderücken müssen.
65 000 Mitarbeitende
haben bereits verschiedenen Schulungen der Bosch „KI Academy” durchlaufen.
Man könnte etwa über die Einführung von KI als Schulfach nachdenken. Nur: Bis das spürbare Effekte zeigen würde, wäre das weltweite KI-Wettrennen wohl längst gelaufen. Insofern sehe ich hier aktuell vor allem die Wirtschaft gefordert. Bei Bosch gibt es bereits seit 2019 entsprechende Trainingsprogramme, mittlerweile haben schon mehr als 65 000 Mitarbeitende die verschiedenen Schulungen unserer „KI Academy“ durchlaufen. Und auf unserer KI-Plattform „Ask Bosch“ stehen allen Mitarbeitenden jede Menge Anwendungen zur Verfügung: Sprachmodelle, Chatbots, Agenten für Übersetzungen und natürlich auch für die Erstellung von Bildern und Texten.
Auch deshalb verfügen wir bei Bosch über das notwendige Know-how, um KI konsequent und passgenau dort einzusetzen, wo wir das größte Potenzial sehen: Dort, wo intelligente und selbstlernende Algorithmen auf Sensoren, Aktuatoren oder Antriebe treffen. Wir wollen dafür aber keine eigenen Large-Language-Modelle entwickeln, sondern die vorhandenen Modelle unserer Partner als Basis nutzen. Zusätzlich arbeiten wir – je nach Anwendung – auch mit eigenen, kleineren Spezialmodellen.

Neben der generativen KI arbeiten wir zunehmend auch mit sogenannter agentischer KI. Beide KI-Formen zusammen werden, ich habe es eingangs angesprochen, völlig neue Welten schaffen. Und dazu gehört auch die Art, wie wir mit der uns umgebenden Technik kommunizieren. Unsere Stimme wird schon bald all die regelnden Hebel und Schalter zunehmend ersetzen. Ob bei Fahrzeugen, Hausgeräten oder Heizungen: Die Zeit der dicken Bedienungsanleitungen geht zu Ende. Und ich freue mich auf eine intelligente Technik, die uns den Alltag erleichtert, die das Leben sicherer und komfortabler macht, die uns immer mehr lästige Routineaufgaben abnimmt – und die wir nicht bedienen, sondern steuern werden. Allein das ist schon ein Epochenschnitt.